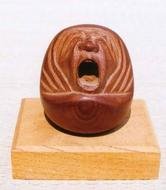[ . BACK to DARUMA MUSEUM TOP . ]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Daruma Pilgrims Gallery
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Opfergaben, Rauchopfer
Gruppen von Opfergaben
Es gibt verschiedene Gruppen von Opfergaben, die entsprechend den Sutras vorgeschrieben sind:
Gruppe von fünf Opfergaben (goshu kuyoomotsu)
Duftpulver zum Einreiben, Blumen, Räucherwerk zum Abbrennen, Speisen und Wasser sowie Lichtopfer.
Gruppe von sechs Opfergaben (rokushu kuyoomotsu)
Dies ist die grundlegende Gruppe von Opfergaben, die vor der Statue eines Heilswesens geopfert werden. Sie werden besonders bei den esoterischen Sekten verwendet: Räucherwerk, Duftpulver zum Einreiben, Blumen (keman) Lichtopfer, Speisen und Heiliges Wasser. In ihrer Symbolik beziehen sie sich auf die "Sechs erringenswerten Vollkommenheiten" (
roku haramitsu; S: paaramitaa) eines Bodhisattva, nämlich Almosen geben (fuse), moralische Reinheit (jikai), Gleichmut und Beharrlichkeit (ninniku), energisches Streben (shoojin), Meditation (zenjoo) und Weisheit zur Erleuchtung (chie).
Gruppe von zehn Opfergaben (jushu kuyoomotsu)
Entsprechend dem Lotus-Sutra. Blumen, Räucherwerk (koo), Schmuckketten, Duftpulver (makko), Duftpulver zum Einreiben, Räucherwerk zum Abbrennen, Fahnen, Kleidungsstücke und Zeremonialmusik.
. roku haramitsu 六波羅蜜 six paramitas,
six religious practices, rokuharamitsu .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Opfergefäße (kuyoogu 供養具)
Opfergefäße (kuyoogu 供養具)
Eine Opferzeremonie (kuyoo) wird im Sanskrit als "puujaa" oder "puujanaa" bezeichnet. Die Opfergaben werden dabei in besonderen Opfergefäßen und Gegenständen für Opferzeremonien vor der Altar-Plattform mit den Buddhastatuen präsentiert. Sie werden daher auch "Buddha-Gefäße" (butsuki, bukki) genannt. Sie sollen die Erhabenheit (yuudaisa) und die Allgewalt seiner Tugenden ausdrücken. Als rituelle Schmuckobjekte wurden sie daher meist aus besonders auserlesenen Materialien hergestellt, um die Umgebung einer Buddhastatue bis ins Extrem hin zu verschönern und zu schmücken.
Es gibt sogar acht eigene Bodhisattvas der Opfergaben (Kuyoo Bosatsu), die das rituelle Spenden von Opfergaben verdeutlichen. Sie finden sich häufig in Dekorationen der Tempelhalle und des Baldachins.
Die Sutras beschreiben verschiedene Arten von Gefäßen zur Präsentation von Opfergaben. Auch innerhalb der Sekten gibt es verschiedene Verwendungszwecke. Die vier wichtigsten Gegenstände, die im folgenden beschrieben werden und sich auch immer in einem buddhistischen Hausaltar (butsudan) finden, sind folgende: Räucherbecken, Blumenvase, Leuchter und Speiseopfergefäß.
Nach Suzuki unterscheidet man
vier große Gruppen von Opfergefäßen:
1. Opfergefäße für Räucherwerk und Duftstoffe (koo kuyoogu)
Seit alter Zeit herrschte in Indien der Brauch, Räucherwerk zu verbrennen, weil viele Dinge in der feuchten, heißen Jahreszeit leicht verschimmeln und verrotten. Anfangs verwendete man Duftstoffe, um die Buddhastatuen, den heiligen Ort und den eigenen Körper zu reinigen, später kam dazu die Vorstellung einer Opfergabe an das Haupt-Heilswesen. Man unterscheidet zwischen Räucherwerk (kunkoo), das in Räucherbecken verbrannt wurde und Duftstoffen, mit denen der Körper eingerieben wurde.
2. Opfergefäße für Blumengaben (ke kuyoogu)
Die Assoziation des Buddhismus mit Blumen, insbesondere mit der Lotusblüte, ist sehr eng. Bereits in Indien wurden dem Buddha Lotusblüten geopfert. Man stellte Blumen in Vasen auf und streute wohlriechende Blütenblätter auf den Weg. Auch Kränze aus Blüten wurden gefertigt.
Zu diesen Gegenständen zählen hauptsächlich Blumenvasen, Schmuckgehänge und der Korb für Streublumen.
3. Opfergefäße für Lichtopfer (shoku kuyoogu)
Der Brauch, am Altar ein Lichtopfer aufzustellen, stammt ebenfalls aus Indien. In Japan wurden bei Ausgrabungen des ältesten Tempels, des Asukadera in der Nähe von Nara, vor der Goldenen Halle bereits Überreste von Steinlaternen gefunden.
Leuchter in Innenräumen hatten eine flache Schale, in die Öl (abura) gegossen und durch einen Docht entzündet wurde. Seit dem 8. Jh. sind auch Kerzen mit einem Docht aus Papier bekannt. Besonders häufig sind Standleuchter aus Holz. Laternen aus Stein oder Bronze finden sich in Tempelgärten. Fackeln (taimatsu) sind ebenfalls eine Art dieser Lichtopfer. Ihre Funken sind glücksbringend
4. Opfergefäße für Speisen (onjiki kuyoogu)
Ursprung sind die normalen Speisegefäße der Mönche und Nonnen einer buddhistischen Gemeinde (sanga). In einer alten Schrift des Tempels Hooryuuji (Rukishizaichoo) werden Bettelschale, flache Bettelschale (tara), Metallschale (kanamari), Löffel (saji), Eßstäbchen (hashi) u.a. erwähnt.
Die Bettelschale war der wichtigste Besitztum eines Mönchs und wurde auch zur Speisenzubereitung benutzt. Bei der Verwendung als Opfergefäß auf der Altar-Plattform wird unter die Bettelschale ein ringförmiger Untersatz gestellt.
Untersetzer für Opfergebäck und Wassergefäße fallen ebenfalls in diese Kategorie.
Im folgenden werden die einzelnen Opfergaben und die dazugehörenden Gefäße ausführlicher besprochen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Incense and Daruma お香とだるま
Rauchopfergaben (sonaekoo 備香)
In diesem Abschnitt wird zunächst das Räucherwerk beschrieben, danach die Gefäße, in denen es aufbewahrt und abgebrannt wird.
Räucherwerk (shookoo, funkoo, nenkoo, takimono)
Incense
Da es sich bei japanischem Räucherwerk um eine Mischung mehrerer Dufthölzer und anderer Duftstoffe handelt, wird als allgemeine Übersetzung nicht "Weihrauch" verwendet, weil echter Weihrauch nur eine der vielen Substanzen ist, die im Räucherwerk enthalten sein kann.
Ursprung:
Räucherwerk wird in Indien und in vielen heißen Ländern Asiens verwendet, um den Geruch nach Moder und Schweiß aus den Räumen zu vertreiben, besonders bei Anwesenheit von Gästen während der kalten Jahreszeit. Dafür wurden Räuchergefäße oder Beutel mit Duftstoffen (koobukuro, nioibukuro ) in den vier Ecken eines Raumes, an Säulen oder an den Wänden aufgehängt (kakekoo). Nach einigen Quellen soll Räucherwerk und Duftholz (kooboku) zuerst von dem blinden chinesischen Priester Chien-chen (Ganjin Wajoo, 687 - 763) um 753 in Japan eingeführt worden sein. Im Schatzhaus Shoosoin des Tempels Toodaiji, Nara, befinden sich die ältesten Stücke Duftholz (ranjatai, oojukukoo, zensenkoo).
Während der Heian-Zeit war unter den Adeligen das Abbrennen von Duftstoffen und Erraten der Zusammensetzung, der "Weg des Duftes" (koodoo) ein besonders beliebtes "Duft-Hobby" (gankoo), das auch heute noch viele Anhänger hat.
Symbolik:
Der Duft von Räucherwerk breitet sich überall hin aus, wie die "alldurchdringende Dharmawelt der absoluten Wirklichkeit" [Seckel]. Räucherwerk ist auch die Speise der Buddhas und der Seelen der Toten.
Funktion:
Symbolische Reinigung des Ortes (kuukoo, soradaki) und der Person. Rauchopfer für die Heilswesen oder für Verstorbene, besonders bei Beerdigungen. In Form von Räucherstäbchen von fast allen buddistischen Sekten verwendet.
Im Soshitsujikarakyoo (Susiddhikara-suutra) wird die Verwendung von Räucherwerk ausführlich beschrieben.
Form: Nach Sawa T. (3) unterscheidet man im esoterischen Buddhismus fünf Arten von duftenden Substanzen zum Abbrennen:
Räucherstäbchen, Räucherpulver, Duftkugeln (gankoo, maruko), grobes Räucherwerk zum Verstreuen (sankoo) und pastenförmiges Räucherwerk (nerikoo).
Material:
Meist eine Mischung der folgenden "fünf Duftsubstanzen" (goshukoo): Aloeholz (jinkoo, chinkoo, jinsuikoo), weißes Sandelholz (byakudan), Borneokampfer "Drachengehirn" (ryuunoo), Gewürznelke (chooji) und Kurkuma (ukon, ukkon). Weitere Substanzen sind echter Weihrauch (nyuukoo, Frankincense) (das transparente, gelbe Harz von Ölbaumarten), Myrrhe (motsuyaku), Amber (ryuuzenkoo), Patchuli (kakkoo), Adlerholzarten (kyara, manaka, sasora, sumondara), Alderholz aus Siam (rakoku), Alderholz von der Malabarküste in Südindien (manaban), Sternanis (daiuikyoo), Zimt (keihi), Benzoe (ansokukoo, ansokkoo ), Duftstoff aus dem Deckel von Trompetenschnecken (kaikoo), Nardenöl bzw. Lavendelöl spikenard (kanshoo) u.a.
Eine ausführliche Auflistung der Substanzen findet sich bei Shimizu.
Diese duftenden Stoffe (kunkoo) werden meist in einem Räucherbecken abgebrannt. Bei Feueropfern des esoterischen Buddhismus werden die Duftkugeln auch direkt in die Flammen geworfen
Für religiöses Räucherwerk wird selten Moschus (jakoo) verwendet.
Es gibt zahlreiche Beispiele von Buddhastatuen, die aus Duftholz geschnitzt sind.
Besondere Typen
 Räucherstäbchen (senkoo 線香)
Räucherstäbchen (senkoo 線香)
Auch "Duft des langen Lebens" (choojukoo) genannt. Incense sticks
Bei der Zen-Sekte häufig verwendet, um die Dauer einer Meditationsperiode zu messen. Besonders lange Räucherstäbchen brennen etwa dreieinhalb oder fünfeinhalb Stunden . Bei der Shingon-Sekte wird außer bei wenigen Zeremonien vor Reliquiaren nur angehäuftes Räucherpulver (morikoo) verwendet.
Für Räucherstäbchen zum religiösen Gebrauch, z.B. als Opfer an einem Grab wird Räucherpulver durch Kneten mit Kiefernharz (matsuyani) und Beigabe von Pulver aus Nadeln einer japanischen Zedernart (sugi, hinoki) geformt.
Zunächst verwendete man einen Bambusstab, um den mit Harz oder Honig vermischtes Pulver aus verschiedenen Duftstoffen geknetet wurde. Die Kunst der Herstellung von Räucherstäbchen, wie sie heute verwendet werden, ist nur etwa 400 Jahre alt.
Räucherstäbchen werden meist in dem Kasten aufgehoben, in dem sie verkauft werden.
Räucherpulver (makkoo ?matsuko)
Häufig wurden Nadeln einer japanischen Zedernart sowie die Blätter von chinesischem Anis (shikimi, shikibi, koonoki) und anderen Pflanzenarten getrocknet und zu Pulver verarbeitet. Die fünf Duftsubstanzen wurden ebenfalls zu Pulver verarbeitet und verbrannt.
Man nimmt etwas Pulver zwischen die Fingerspitzen der rechten Hand, hebt die Hand zum Gruß an die Stirn und legt dann das Pulver auf ein Stück glühende Kohle, die im Räucherbecken liegt. Bei Beerdigungen macht man diese Bewegung häufig drei mal.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Gefäß zum Aufbewahren von Räucherpulver
Gefäß zum Aufbewahren von Räucherpulver
(kongoo, koogoo 香合, koobako)
Weihrauchdose.
Funktion: Sie dienen dem Aufbewahren von Räucherpulver.
Form: In der Nara-Zeit gab es runde Schalen mit hohem Fuß (goosu) mit einem Deckel in Pagodenform (toomari). Seit der Kamakura-Zeit findet man auch runde, flache Dosen. Heutzutage gibt es auch Gefäße in Form einer Medizindose (inroogata koogoo).
Material: Metall, Porzellan, Elfenbein, Lackarbeiten mit Perlmuttintarsien. Geschnitztes Holz mit rotem Lacküberzug (kamakurabori). Gefäße der Zen-Sekte sind meist dick mit rotem oder schwarzem Lack überzogen (taishu, taikoku ), in den dann Muster geschnitzt wurden (chooshitsu).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Gefäße zum Abbrennen von Räucherwerk
Gefäße zum Abbrennen von Räucherwerk
Es gibt zahlreiche Variationen derartiger Gefäße, entsprechend der Sekte und dem Zeitgeschmack. Hier können nur die wichtigsten besprochen werden.
Räucherbecken (kooro 香炉)
Räuchergefäß.
In zusammengesetzten Lesungen häufig "gooro" ausgesprochen. Im folgenden Text wird in diesem Fall nur diese Bezeichnung verwendet.
Form:
Es gibt zahlreiche besondere Typen, die im folgenden nur teilweise einzeln erwähnt werden können. Eine ausführliche Darstellung findet sich bei Suzuki. Bei einer Gruppe von drei Gegenständen ist das Räucherbecken oft rechteckig, mit einem Deckel mit Knauf und Füßen in Menschenform (igyoo jinbutsu).
Material:
Verschiedene Metallarten, z.B. Gold, Silber, Nickel (hakudoo ?shirodoo), Legierungen von Kupfer und Zink (chuujaku) oder Kupfer (shakudoo ?akadoo) . Keramik, Elfenbein (zooge), Lapislazuli oder rotes Sandelholz (shitan, shakudan ?murasaki).
Besondere Typen
Dreibeiniges Räucherbecken
(mitsuashigooro) sansoku
Einfachste Form eines Räucherbeckens mit drei Beinen und ohne Deckel. Der Körper ist eimerförmig (okegata), topfförmig (tsubogata), schalenförmig (hachigata) oder anderweitig gestaltet. Er kann mit Mustern in Form von Päonien oder chinesischen Arabesken ausgestattet sein. Manchmal ist der Rand nach außen gewölbt.
Besonders große Räucherbecken stehen vor der Tempelhalle. Sie sind im allgemeinen aus Metall und durch ein Dach vor Regen geschützt.
Hängendes Räucherbecken (tsurigooro)
Hängt besonders an den Wänden von Gästezimmern, um schlechte Gerüche zu überdecken. Es ist nicht eigentlich ein Kultgegenstand des Buddhismus. Es wurde auch von Mönchen auf Reisen mitgenommen oder bei Askeseübungen im Freien an einem Baum aufgehängt.
Rundes Räucherbecken mit drei Füßen und zwei Griffen bzw. Henkeln (totte).
Hängt an einer Kette, die zum Aufhängen durch einen Ring geführt wird.
Kelchförmiges Räucherbecken auf hohem Fuß (suegooro)
Auch "Räuchergefäß zum Aufstellen" (okigooro) genannt.
Es steht auf der Altar-Plattform oder auf einem Seitentisch. Es gehört zu den drei bzw. fünf Gegenständen.
Nach Shimizu gibt es neun Untergruppen des "suegooro", die nachfolgend beschrieben werden:
1. Räucherbecken mit bergförmigem Deckel, 2. Lotus-Räucherbecken, 3. Räucherbecken des Tempels Kinzanji, 4. Räucherbecken mit Oktopus-Füßen, 5. Kesselförmiges Räucherbecken, 6. Dreibeiniges Räucherbecken, 7. Räuchertablett, 8. Weihrauchbrenner und 9. Kannon-Räucherbecken.
Kesselförmiges Räucherbecken (kanaegatagooro)
Räucherbecken in Form der Bronze-Ritualgefäße aus der chinesischen Shang-Dynastie LI bzw. TING, die zum Zubereiten von Opferspeisen verwendet wurden. Sie haben an beiden Seiten einen Henkel. Während der Song-Dynastie wurden diese Gefäße oft aus Porzellan gefertigt und von Buddhisten als Räucherbecken verwendet.
In Japan wurden sie während der Kamakura-Zeit von der Zen-Sekte eingeführt.
Seltene Formen haben keinen Henkel und keinen Deckel. Runde Formen (TING) haben drei Beine, während viereckige Formen vier Beine haben.
Siehe Anmerkung Seckel im Manuskript.
Lotusförmiges Räucherbecken (rengegatagooro)
Frühe Gefäße stammen aus der Heian-Zeit.
Der Fuß des runden Gefäßes ist in Form von nach unten weisenden Lotusblüten (kaeribana) ausgebildet, während der eigentliche Gefäßkörper einer Lotusknospe (mifugata) oder einer geöffneten Lotusblüte (kaifugata) entspricht . Der Deckel ist ähnlich einer Lotuskapsel und enthält entsprechende Löcher.
Eine besondere Variante ist das Räucherbecken in Form der Keimsilbe "hrih" (kirikujigooro), bei dem der Griff die Form eines Donnerkeils mit einer Spitze als Symbol des Kannon Bosatsu hat. Auf dem Deckel sind die fünf Keimsilben "om, va, jra, dha, rma" linienförmig eingraviert. In der Mitte des Beckens ist die Keimsilbe "hrih" für Amida Nyorai (das gleiche wie für einen Tausendarmigen Kannon (Senju Kannon; Sahasrabhuja) eingraviert. Diese Schriftzeichen ergeben zusammengenommen das Mantra (shingon) des Tausendarmigen Kannon. Derartige Räucherbecken wurden hergestellt, um Brandkatastrophen abzuwehren und den Weg der Seele ins Paradies zu erleichtern.
Räucherbecken des Tempels Kinzanji
(kinzanjigooro)
Dieser Typ hat seinen Ursprung in koreanischen Tempeln der Hossoo-Sekte (hossooshuu). Später wurde diese Form auch in Japan hergestellt; in der Muromachi-Zeit erfreute es sich besonderer Beliebtheit.
Ringförmiger Fuß und kugelförmiger Körper. Stark erhöhter Rand und kein Deckel. Größe: Gesamthöhe 28 cm; Durchmesser der Öffnung 18,5 cm; Tiefe des Räucherbeckens 15,3 cm. Bei japanischen Modellen ist der Rand nicht so stark erhöht und der Teil zwischen Körper und Fuß durch Wülste betont.
Räucherbecken mit bergförmigem Deckel
(hakusangooro, hakusanro )
Die ältesten Gegenstände aus Bronze sind aus der Han-Dynastie in China bekannt. Sie stammen also aus der vorbuddhistischen Zeit.
Dieses Räuchelrbecken steht meist auf einem kleinen Tisch für Opfergaben vor der Buddhastatue im Tempel.
Rundes Gefäß mit einem hochgewölbten, bergförmigem Deckel, in dem sich zahlreiche Löcher befinden.
Räucherbecken mit Oktopus-Füßen (takoashigooro)
Von der Zen-Sekte während der Kamakura-Zeit in Japan eingeführt.
Großes rundes Bronzebecken mit sechs hohen Beinen zur Stütze und dazwischen weitere sechs kurzen Beinen zur Verzierung. Die langen Beine können über einen Meter lang sein. Insgesamt erinnert diese Form an die Beine eines Oktopus. Am Ansatz der Beine befinden sich Dämonenmasken. Der Beckenkörper ist mit Blattmustern oder anderen Mustern verziert. Manchmal ähneln die Muster auch Pfauenfedern (kujakugooro).
Kannon-Räucherbecken (myookooin kirijigooro)
Diese Typen wurde bereits seit der Tang-Dynastie in China verwendet.
Sie finden sich besonders vor Statuen des Kannon Bosatsu. Pulverförmiges Räucherwerk wird in der Form des Buchstabe "hrih" des Siddham-Alphabets ausgelegt. Auf dem gewölbten Deckel steht aufrecht ein Donnerkeil mit einer Spitze als Symbol des Kannon. Oben auf dem Donnerkeil befindet sich eine achtblättrige Lotusblüte als Deckelknauf. Auf dem Deckel sind die Keimsilben "om, va, jra dha" und "ram" zum Rauchauslaß ausgeschnitten.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Räucherpfanne mit Griff (egooro, ekooro 柄香炉)
Räucherpfanne mit Griff (egooro, ekooro 柄香炉)
Weihrauchbrenner mit Griff.
Dieser Typ eines Räucherbeckens ist einer der ältesten Kultgegenstände, die zusammen mit dem Buddhismus aus Indien nach Japan kamen. Derartige Gefäß wurde bei Zeremonien in der Hand gehalten (shuro) und herumgetragen, um den Rauch im Tempelraum und über den Gläubigen zu verteilen.
Form:
Der Griff (gara) ist im allgemeinen etwa 20 bis 30 cm lang. Er kann aus Holz mit Lacküberzug bestehen. Manchmal ist er mit Baumwollstreifen umwickelt. Am Ansatz des Griffs befinden sich verschiedenartige Verzierungen, die bei den einzelnen Typen erwähnt werden. Die Pfanne ist klein und offen, meist mit einem betonten Rand in Form einer Trichterwinde (asagaogata). Häufig ohne Deckel. Der Fuß ist angesetzt, meist rund.
Material:
Bronze, Kupfer oder Nickel. Selten Holz, z.B. rotes Sandelholz.
Entsprechend der Form des Griffs und der Pfanne unterscheidet man weiterhin verschiedene Typen von Räucherbecken:
. . . . . Nach dem Griff:
Räucherpfanne mit Elsterschwanz-Griff
(shakuogata, jakubigata egooro)
Der nach unten gebogene Teil des Griffs ist dreifach geschweift und ähnelt dem Schwanz einer Elster (kasasagi), daher die Bezeichnung. Am Ansatz der Pfanne finden sich oft zwei halbkugelförmige Verzierungen. Die Pfanne ist etwas tiefer als bei anderen Räucherpfannen dieser Art. Der Pfannenrand ist mehr oder weniger ausgeprägt nach außen gebogen. Der Fuß ist meist mit einem Steg an der Pfanne befestigt. Er kann wie zwei übereinandergelegte achtblättrige Lotusblüten geformt sein.
Räucherpfanne mit Miniaturlöwe am Griffende
(shishichin egooro)
Seit der Nara-Zeit in Japan verbreitet.
Auf dem umgebogenen Teil des Griffs befindet sich eine kleine Löwenfigur (shishigata chinsu ?chinko). Die Pfanne ist etwas flacher als die einer Räucherpfanne mit Elsterschwanz-Griff. Der Fuß in Form einer Chrysantheme (kikuza). Der Griff hat in der Mitte eine Rinne (mizo). Am Ansatz des Griffs eine aprikosenblattförmige Verzierung (gyooyoogata) mit zwei halbkugelförmigen, aufgesetzten Nieten (byoo) oder anderen Dekorationen.
Räucherpfanne mit Miniaturvase am Griffende
(byoochin egooro)
Seit der Heian-Zeit in Japan verbreitet.
Auf dem umgebogenen Teil des Griffs befindet sich eine kleine Miniaturvase. Die Pfanne ist relativ flach, manchmal in Form einer Reisschale (chawan). Der Fuß in Form einer Chrysantheme. Der Griff hat in der Mitte eine Rinne. Am Ansatz des Griffs eine aprikosenblattförmige Verzierung mit zwei halbkugelförmigen, aufgesetzten Nieten oder anderen Dekorationen. Seit der Nara-Zeit auch mit Deckel.
Lotusförmige Räucherpfanne mit Griff
(rengegata egooro)
Seit der Kamakurz-Zeit in Japan verbreitet.
Die Pfanne hat die Form einer offenen Lotusblüte, der Fuß ist wie ein umgekehrt liegendes Lotusblatt geformt. Der Griff sieht aus wie das Blatt mit Stiel einer Lotuspflanze.
Meist aus Holz mit Lacküberzug oder aus Bronze.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Räuchertablett (kooinban, kooban香盤,
jookooban, kooinza, kootenban )
Es handelt sich um ein besonderes Räuchergefäß vor einer Buddhastatue, in dem für eine längere Zeitdauer Räucherwerk abgebrannt wird. Seit der Nara-Zeit in Japan verwendet.
Räucherpulver wird in Form von Keimsilben oder komplizierten Mustern auf einem Tablett ausgelegt und dann vom Rand aus angezündet. Durch die gleichmäßige Auslegung des Pulvers konnte man die abgelaufene Zeit messen.
Der Bodenteil besteht aus mehreren Lagen von Lotusblättern, die eine runde Platte tragen. Der runde Deckel zeigt oft ein Swastikazeichen mit Gitterwerk zum Rauchauslass und besitzt einen Deckelknauf in Form eines Wunschjuwels.
Material: Holz, mit Lacküberzug. Metall.
In esoterischen Buddhismus werden zwei besondere Typen von Räuchergefäßen verwendet, der Weihrauchbrenner und das Räuchergefäß in Elefantenform.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Weihrauchbrenner (kasha 火舎香炉,
kashagooro, kasha kooro ?kashuku)
Weihrauchbrenner (kasha 火舎香炉,
kashagooro, kasha kooro ?kashuku)
Diese Form eines Räucherbeckens ist ein besonderer Gegenstand des
esoterischen Buddhismus. Zur einfacheren Unterscheidung gegenüber anderen Räucherbecken wird die Übersetzung "Weihrauchbrenner" gewählt. Es wird aber nicht nur Weihrauch darin abgebrannt, sondern die bereits beschriebenen Mischungen von Räucherwerk.
Siehe auch die Anordnung der Gegenstände auf einem esoterischen Altar, ab Seite xx.
Ursprung: Wahrscheinlich in China. Derartige Gefäße sind bereits auf den Wandgemälden der Höhlentempel in Dunhuang abgebildet.
Funktion:
Zum Abbrennen von Räucherwerk bei Zeremonien des esoterischen Buddhismus auf dem Großen Altar. Dabei stehen vier Weihrauchbrenner an den vier Ecken eines Altars und einer in der Mitte.
Form:
Im allgemeinen ein flaches Räucherbecken mit breitem Rand, drei Füßen und einem gewölbten Deckel (morifuda, koomorigata) mit einem Deckelknauf in Form eines Wunschjuwels. Mit einem Deckel sieht es aus wie ein kleines Haus mit Dach, daher der Name, der wörtlich übersetzt "Feuerhütte" bedeutet.
Die Füße sind bei älteren Gegenständen zunächst klein und haben die Form von Katzenfüßen, später werden sie größer und zeigen am Ansatz des Klauenfußes eine Tiermaske, sog. Tierkopffüße (juusoku). Katzenfüße finden sich besonders häufig bei sehr großen Räucherbecken.
Auf dem Becken (karo) befindet sich ein Deckel. Der Deckel ist durchbrochen gefertigt, um den Rauch auszulassen und die Öffnungen dienen gleichzeitig der Verzierung, z.B. in Wolkenform, Herzform, Form eines Wunschjuwels oder Durchbrüche wie Wildschweinaugen bzw. Eberaugen (inome sukashi ). Der Deckelknauf (tsumami, chuu ) ist in Form eines Wunschjuwels oder in Form einer kleinen Pagode (toomarigata kosu). Der Deckel selbst ist stark gewölbt (koomorigata kaimorigata) und hat zwei Einschnürungen (nidan kubire).
Einfache, ältere Formen seit der Heian-Zeit bestehen nur aus dem Becken und einem Deckel, während spätere Formen seit der Kamakura-Zeit dazwischen als Mittelteil noch einen ringfömigen Einsatz (koshiki) besitzen.
Eine besondere Form besitzt anstatt der drei Füße einen Standring mit Lotusblütendekor.
Seit der Muromachi-Zeit findet man eine einfache runde Dosenform mit einem Deckel, in dem sich ein Swastikazeichen (manji) für den Rauchauslass befindet, das sog. Räucherbecken mit Swastaikaöffnung (manjigooro) .
Material: Vergoldete Bronze, Gold, Silber, Nickel, Kupfer, Bronze, Porzellan, Elfenbein, Lapislazuli, rotes Sandelholz u.a.
Beispiel: Im Schatzhaus Shoosooin des Tempels Toodaiji, Nara, gibt es ein besonders berühmtes Räucherbecken aus weißem Marmor (hakuseki kasha).
Räuchergefäß in Elefantenform
(zooro, koozoo, zookoo)

Funktion:
Steht vor einer Buddhahalle (butsuden) oder einer Meditaitons- bzw. Übungshalle in Tempeln des esoterischen Buddhismus. Besonders bei Initiationszeremonien steht es am Eingang der Halle. Der Initiand muß sich darauf setzen oder mit dem rechten Fuß zuerst darübersteigen , um seinen Körper rituell zu reinigen. Dieser Brauch ist bereits seit der Tang-Dynastie in China bekannt. Es gibt nur wenige Beispiele dieser Art.
Form:
Liegender, selten auch stehender Elefant, an dessen Rücken sich eine Öffnung mit einem Bronzeeinsatz befindet. Der Elefant wendet seinen Kopf nach hinten.
Material: Holz oder Porzellan.
My Literature Register Literaturverzeichnis
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BACK ... ZUM INHALTSVERZEICHNIS
Buddhistische Kultgegenstände Japans
Daruma Pilgrims in Japan
O-Fudo Sama Gallery
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::





 This deity comes from Shinto, but with the mixing of Buddhism and Shinto he has been called on with a wish for children or a good relationship.
This deity comes from Shinto, but with the mixing of Buddhism and Shinto he has been called on with a wish for children or a good relationship.